Evolution im Kindergarten
Was Kinder über grundlegende Prinzipien der Evolution denken
von Isabell K. Adler
Die Annahme, dass abstrakte naturwissenschaftliche Konzepte für junge Kinder zu kompliziert seien und man sie deshalb in der frühkindlichen Bildung gar nicht erst thematisieren solle, ist weitverbreitet. Dabei haben Kinder zu Beginn der Schulzeit bereits vielfältige Ideen zu komplexen Themen – wie beispielsweise zu grundlegenden Prinzipien der Evolution. Gemeinsam mit meinen Co-Autorinnen habe ich Interviews mit Kindergartenkindern durchgeführt, um diese Ideen systematisch zu beschreiben.

Viele Schüler*innen haben Schwierigkeiten, das Konzept der Evolution zu verstehen. Die Forschung legt nahe, dass sich bereits im Kindesalter intuitive, jedoch wissenschaftlich nicht korrekte Vorstellungen herausbilden. Einerseits manifestieren sich diese Vorstellungen im Laufe der Kindheit und Jugend, wodurch es schwerer wird, diese Vorstellungen zu verändern. Andererseits braucht es viel Zeit für Schüler*innen, das komplexe Thema Evolution wirklich zu durchdringen. Daher gibt es ein wachsendes Forschungsinteresse an der Frage, ob und wie die Integration des Themas Evolution im frühen Naturkundeunterricht gelingen kann, denn dadurch könnte das wissenschaftliche Denken gefördert und das spätere Lernen über Evolution in der Schule erleichtert werden.
Evolution kann grob anhand von drei Prinzipien beschrieben werden:
1. Variabilität beschreibt, dass Individuen einer Art unterschiedlich sind.
2. Vererbung beschreibt, dass Individuen einer Art sich fortpflanzen und dabei ihre Merkmale weitergeben.
3. Selektion beschreibt, dass Individuen durch das begrenzte Angebot an Ressourcen wie Nahrung, Wasser oder Lebensraum unterschiedlich erfolgreich im Überleben und in der Fortpflanzung sind. Wenn ein Merkmal die Überlebens- oder Fortpflanzungschancen eines Individuums verbessert, führt dies dazu, dass Individuen mit diesem Merkmal länger leben und mehr Nachkommen haben. Diese Nachkommen ähneln ihren Eltern und besitzen wahrscheinlich ebenfalls das Merkmal, das ihnen einen Vorteil verschafft. Sie haben daher widerum eine höhere Wahrscheinlichkeit, mehr Nachkommen zu zeugen als Individuen ohne dieses Merkmal. Im Laufe mehrerer Generationen nimmt die Häufigkeit dieses Merkmals in der Population zu. Dadurch kann sich beispielsweise das Erscheinungsbild einer Art über einen langen Zeitraum hinweg verändern, da die meisten Individuen Nachkommen derjenigen sind, die das vorteilhafte Merkmal hatten.
Die Studien in diesem Bereich befassen sich vor allem mit den bereits vorhandenen Ideen von Kindern: Sie beschreiben diese, erklären, wie diese mit psychologischen Strukturen zusammenhängen, und testen, wie sich Interventionen (zum Beispiel das Lesen von Kinderbüchern) auf das Verständnis der Kinder auswirken. Welche Ideen Kinder zu den evolutionären Prinzipien haben, wurde bisher in vereinzelten Studien zu Einzelaspekten erforscht (wie beispielsweise zu dem Konzept Vererbung oder zur Entstehung von Arten). Bisherige Studien beschränken sich jedoch auf die Betrachtung einzelner Aspekte, ohne dabei einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Außerdem fokussieren sich alle veröffentlichten Studien auf die Ideen von Kindern zu Tieren, während es noch keine Studien zu den Ideen von Kindern zu Pflanzen gibt.
Unser Ziel war es, einen umfassenden Überblick über die Ideen von Kindern zu den drei Prinzipien der Evolution – Variabilität, Vererbung und Selektion – zu erhalten sowie ihre Ideen im Kontext von Pflanzen zu beleuchten. Dazu haben wir Interviews mit Kindergartenkindern im Alter von fünf bis sechs Jahren durchgeführt, um folgende Forschungsfragen zu beantworten: Welche Vorstellungen haben Kinder über Variabilität, Vererbung und Selektion? Und welche Unterschiede zeigen sich in ihren Ideen je nach Kontext, also je nachdem, ob es um Tiere oder um Pflanzen geht?
Mit Kindergartenkindern über Evolution sprechen
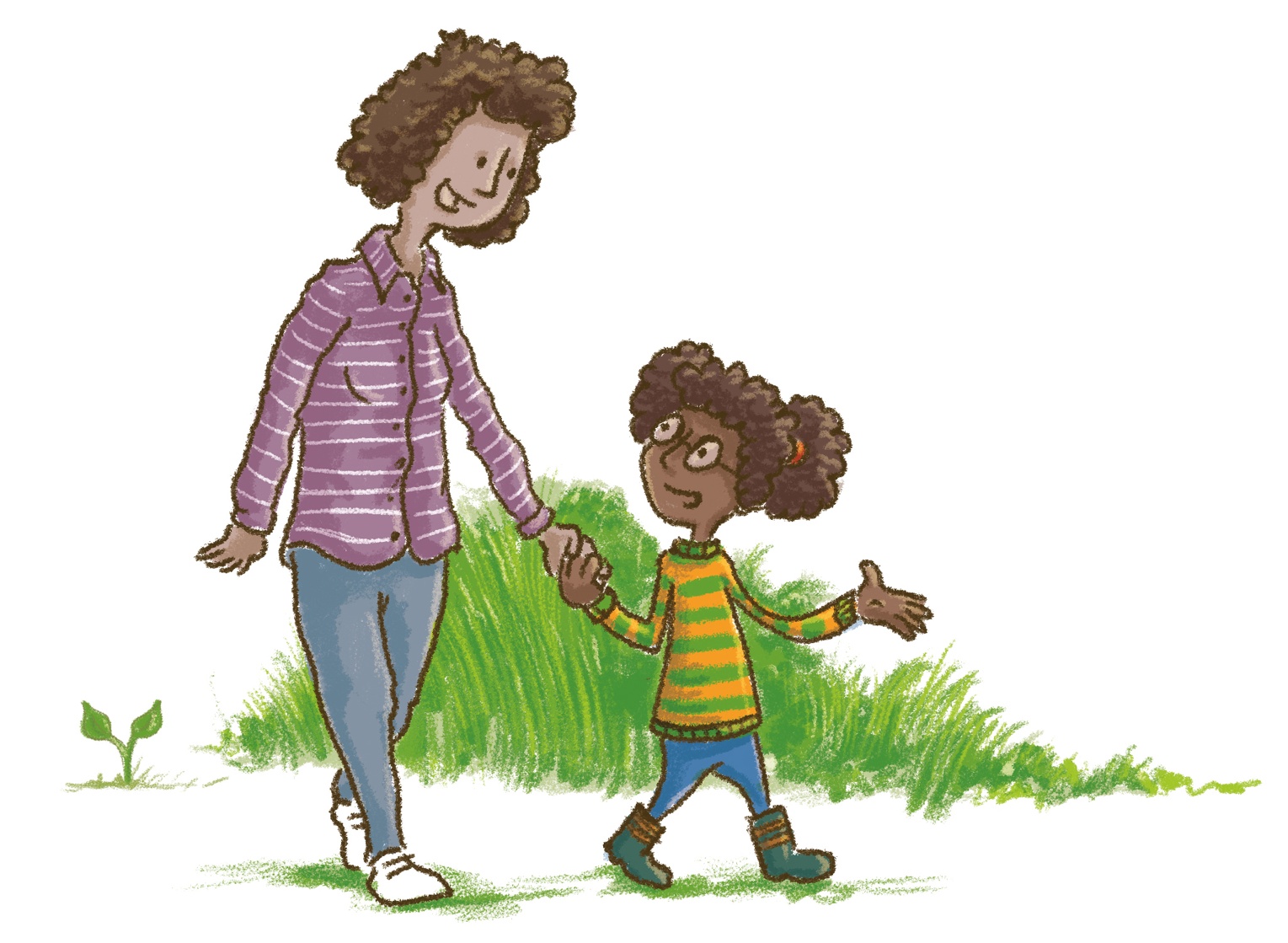
Die Forschung mit Kindergartenkindern bringt einige Schwierigkeiten mit sich, denn sie verfügen noch nicht über viel Fachwissen und haben Schwierigkeiten, komplexe Sätze oder Fachbegriffe zu verstehen. Um über ein komplexes Thema wie Evolution zu sprechen, muss das Thema also zunächst auf eine verständliche Ebene heruntergebrochen werden. Dies kann erreicht werden, indem die Fragen in einen Kontext gebracht werden, der für die Kinder nachvollziehbar ist.
Manchmal kann es hier zu Missverständnissen kommen, sodass die Forscher*innen genauer nachfragen müssen. In dem von uns entwickelten Interviewleitfaden wurden daher weitere Nachfragen vorbereitet, um sicherzustellen, dass die Fragen von den Kindern in der beabsichtigten Weise verstanden wurden. Anstatt zu fragen„Variieren die Individuen einer Art in ihrem Phänotyp?“ fragt man zum Beispiel: „Schau mal. Dieser Fuchs hat eine weiße Schwanzspitze. Was glaubst du, hat jeder Fuchs eine weiße Schwanzspitze?“ Anstatt zu fragen: „Pflanzen sich Schnecken sexuell fort?“ fragt man beispielsweise: „Was glaubst du? Hat eine Schnecke Mutter und Vater?“
Kinder und Erwachsene haben oft unterschiedliche Vorstellungen von Tieren und Pflanzen. Ein weit verbreiteter Glaube ist, dass Pflanzen weniger lebendig seien als Tiere. Das liegt vor allem daran, dass wir Lebendigkeit mit Bewegung assoziieren und Bewegungen von Pflanzen schwerer zu beobachten sind. Zudem verfügen die meisten Menschen über mehr Wissen zu Tieren. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass im Biologieunterricht häufiger Beispiele von Tieren verwendet werden und sich auch die meisten Sachbücher und Naturdokumentationen auf Tiere konzentrieren. Ein weiterer Grund könnte ein mangelndes Interesse an Pflanzen sein.
Ergebnisse
Die Ergebnisse zeigen, dass Kindergartenkinder bereits eine Vielzahl an Vorstellungen haben, die grundlegend für einen Wissensaufbau zum Thema Evolution sind. Zum Beispiel gehen die meisten Kinder davon aus, dass heute lebende Arten nicht schon immer auf der Erde existiert haben, sondern erst später entstanden sind. Die Mehrheit der Kinder begründet ihre Annahme mit dem Wissen um die Dinosaurierzeit, da ihnen bewusst ist, dass zu dieser Zeit andere Tiere und Pflanzen existierten. Einige wenige Kinder wiesen sogar weit fortgeschrittene Ideen auf und nannten bereits die Evolution als Ursache zur Entstehung neuer Arten. Wenig überraschend fehlt den meisten Kindern jedoch noch das Wissen, um zu erklären, wie diese Arten entstanden sind.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick
- Die meisten Kinder zeigten ein solides Verständnis von innerartlicher Variabilität, es fehlte ihnen jedoch noch an Wissen darüber, wie innerartliche Variabilität zustande kommt. Anstatt die Ursache dieser Unterschiede zum Beispiel bei den Eltern der jeweiligen Individuen zu suchen (Individuen sehen unterschiedlich aus, da sie verschiedene Eltern haben), führten die Kinder das unterschiedliche Aussehen auf Faktoren wie das Alter (z.B. «Dieser Baum könnte schon älter sein»), Geschlecht oder äußere Einflüsse zurück (z.B. «Die Blüten könnten angemalt worden sein»).
Überraschenderweise wurden bis auf zwei Ausnahmen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Beispielen von Tieren und Pflanzen festgestellt:

- Die Mehrheit der Kinder ist sich der Tatsache bewusst, dass es zwei Elternteile braucht, damit ein Tier auf die Welt kommt. Im Gegensatz dazu gingen die Kinder bei Pflanzen davon aus, dass diese sich nur ‘asexuell’ (d.h. Pflanzen haben nur ein Elternteil) oder ‘abiologisch’ fortpflanzen würden (z.B. Samen werden in Fabriken produziert oder im Supermarkt eingekauft). Tatsächlich vermehren sich aber die Pflanzen, die uns im Alltag begegnen, gewöhnlich geschlechtlich, indem ihre Pollen zum Beispiel durch Wind oder Tiere zu anderen Pflanzen der gleichen Art gelangen, die dann Samen ausbilden.
- Die befragten Kinder äußerten bei Pflanzen häufiger die Vorstellung, dass diese von Menschen abhängig seien. Kinder erleben Pflanzen häufig als von Menschen kultiviert, beispielsweise im Kontext der Haltung von Hauspflanzen, des Gärtnerns oder möglicherweise sogar beim Anbau von Obst und Gemüse in der Landwirtschaft. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass einige Kinder die Vorstellung hatten, Tiere seien ein Produkt der Natur, während Pflanzen vom Menschen erfunden worden wären. Das könnte auch die Annahme erklären, Pflanzen könnten ohne den Menschen nicht überleben, da sie regelmäßig gegossen werden müssten. Auch gingen die befragten Kinder häufig davon aus, dass Pflanzen nur dort wüchsen, wo Menschen vorher ihre Samen eingepflanzt haben. Dabei erfolgt die Ausbreitung von Samen in der Natur hauptsächlich durch Wind oder Tiere. Pflanzen brauchen die Menschen also nicht.
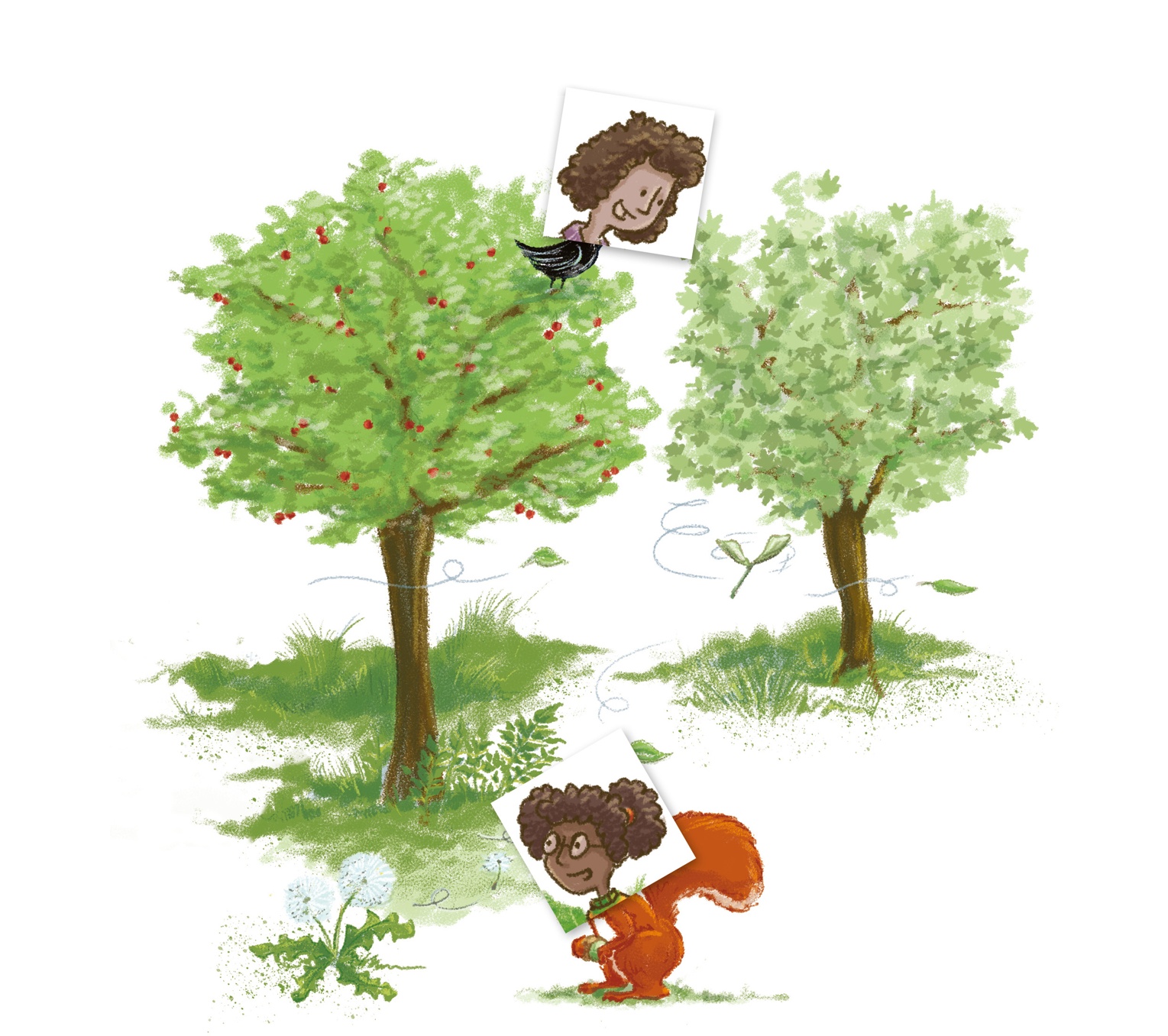
Literatur:
Adler, I. K., Fiedler, D., & Harms, U. (2024).
About birds and bees, snails and trees: Children's ideas on animal and plant evolution. Science Education, 108(5), 1356–1391. https://doi.org/10.1002/sce.21873
Fazit
Kinder haben bereits im Kindergartenalter erste Vorstellungen über evolutionäre Prinzipien. Lerngelegenheiten, wie beispielsweise Kinderbücher, Lernvideos, Naturerfahrungen oder Experimente, sollten bestrebt sein, an diese vorhandenen Ideen anzuknüpfen. Das Thema Vererbung sowie die Fortpflanzung von Pflanzen könnten vielversprechende Ausgangspunkte sein, um die Vorstellungen von Kindern über grundlegende evolutionäre Konzepte zu bereichern. Die Ergebnisse der hier vorgestellten Studie deuten zudem darauf hin, dass Kinder einen ähnlichen Wissensstand zu Tieren und Pflanzen aufweisen. Fehlende Lernmöglichkeiten bezüglich Pflanzen könnten jedoch zu einer unausgewogenen Wissensbasis führen und Missverständnisse verstärken. Außerdem sollte darauf geachtet werden, Pflanzen nicht ausschließlich im Kontext künstlichen Anbaus sichtbar zu machen, sondern durch Kinderbücher oder Naturerfahrungen das Bild von Pflanzen als natürlich vorkommende Lebewesen zu untermauern. Im Anschluss an die hier vorgestellte Studie wurde daher ein Kinderbuch gestaltet, in dem Variabilität, Fortpflanzung und Vererbung anhand von Pflanzen erklärt werden.
Über die Autorin:

Dr. Isabell K. Adler hat 2023 in der Abteilung für
Didaktik der Biologie am IPN promoviert und arbeitet
nun als PostDoc an der Pädagogischen Hochschule Bern.
Isabell.adler@phbern.ch









